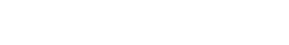La chapelle – 3B Scientific Anthropological Skull Model - La Chapelle-aux-Saints User Manual
Page 4

®
Deutsch
La Chapelle
• Genaue Bezeichnung: La Chapelle-aux-Saints
• Genaue Bezeichnung: La Chapelle-aux-Saints
• Homo (sapiens) neanderthalensis (klassischer Neandertaler oder später Neandertaler)
• Gruppe: Neandertaler
Das Modell wurde nach einem Abguss der Nachbildung aus der Sammlung der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen, entwickelt.
Der Schädel von La Chapelle wurde 1908 in Südfrankreich gefunden. Es handelt sich um den Schädel eines
Mannes im Alter von 50 bis 55 Jahren. Er ist, wie die meisten Schädel der europäischen Neandertaler der
letzten Eiszeit, durchweg groß, was sowohl für den Gehirn- als auch für den Gesichtsschädel gilt (nur die
Schädelhöhe ist gering). Die sehr erhebliche Schädellänge reicht bei erwachsenen Neandertalern stets
über 190, meist über 200 mm hinaus. Bei La Chapelle erreicht die größte Schädellänge sogar 208 mm.
Diese Werte liegen im Mittel weit über denen des rezenten Menschen. Die Schädelbreite ist besonders im
Stirnbereich groß, und der Horizontalumfang des Schädels beträgt 590 bis 600 mm (der letztgenannte Wert
Stirnbereich groß, und der Horizontalumfang des Schädels beträgt 590 bis 600 mm (der letztgenannte Wert
gilt auch für La Chapelle). Das Hirnschädelvolumen übersteigt in der Regel 1500 cm
gilt auch für La Chapelle). Das Hirnschädelvolumen übersteigt in der Regel 1500 cm
3
und beträgt beim vor-
liegenden Schädel 1620 cm
3
. Im Vergleich zum rezenten Menschen ist der Schädel niedrig bis mittelhoch,
. Im Vergleich zum rezenten Menschen ist der Schädel niedrig bis mittelhoch,
hinsichtlich der erheblichen Länge allerdings sehr niedrig.
hinsichtlich der erheblichen Länge allerdings sehr niedrig.
Die Tori supraorbitales (Überaugenwülste) stellen einen kräftigen Knochenvorsprung dar, an dem sich
Die Tori supraorbitales (Überaugenwülste) stellen einen kräftigen Knochenvorsprung dar, an dem sich
Die Tori supraorbitales (Überaugenwülste) stellen einen kräftigen Knochenvorsprung dar, an dem sich
Die Tori supraorbitales (Überaugenwülste) stellen einen kräftigen Knochenvorsprung dar, an dem sich
die fliehende Stirn anschließt. Die Überaugenwülste der Neandertaler stehen nicht in phylogenetischer
die fliehende Stirn anschließt. Die Überaugenwülste der Neandertaler stehen nicht in phylogenetischer
die fliehende Stirn anschließt. Die Überaugenwülste der Neandertaler stehen nicht in phylogenetischer
die fliehende Stirn anschließt. Die Überaugenwülste der Neandertaler stehen nicht in phylogenetischer
Beziehung zu denen der Menschenaffen, sondern müssen als Konvergenzen aufgefaßt werden. Dies
Beziehung zu denen der Menschenaffen, sondern müssen als Konvergenzen aufgefaßt werden. Dies
Beziehung zu denen der Menschenaffen, sondern müssen als Konvergenzen aufgefaßt werden. Dies
Beziehung zu denen der Menschenaffen, sondern müssen als Konvergenzen aufgefaßt werden. Dies
ergibt sich aus der Lage der Stirnhöhlen. Bei den Affen liegt sie stets hinter dem Torus, wogegen sie beim
ergibt sich aus der Lage der Stirnhöhlen. Bei den Affen liegt sie stets hinter dem Torus, wogegen sie beim
ergibt sich aus der Lage der Stirnhöhlen. Bei den Affen liegt sie stets hinter dem Torus, wogegen sie beim
ergibt sich aus der Lage der Stirnhöhlen. Bei den Affen liegt sie stets hinter dem Torus, wogegen sie beim
Neandertaler den Wulst ausfüllen. Entgegen früheren Auffassungen kommt folglich auch dem Sinus fronta-
Neandertaler den Wulst ausfüllen. Entgegen früheren Auffassungen kommt folglich auch dem Sinus fronta-
Neandertaler den Wulst ausfüllen. Entgegen früheren Auffassungen kommt folglich auch dem Sinus fronta-
Neandertaler den Wulst ausfüllen. Entgegen früheren Auffassungen kommt folglich auch dem Sinus fronta-
®
®
Neandertaler den Wulst ausfüllen. Entgegen früheren Auffassungen kommt folglich auch dem Sinus fronta-
lis keine phylogenetische Bedeutung zu.
lis keine phylogenetische Bedeutung zu.
Das Hinterhaupt wirkt in der Seitenansicht abgeflacht und ausgezogen und ähnelt in der Hinter-hauptansicht
Das Hinterhaupt wirkt in der Seitenansicht abgeflacht und ausgezogen und ähnelt in der Hinter-hauptansicht
Das Hinterhaupt wirkt in der Seitenansicht abgeflacht und ausgezogen und ähnelt in der Hinter-hauptansicht
Das Hinterhaupt wirkt in der Seitenansicht abgeflacht und ausgezogen und ähnelt in der Hinter-hauptansicht
einem breitgerundeten Oval. Der Warzenfortsatz ist klein. Der Gesichtsschädel erscheint im Vergleich zum
einem breitgerundeten Oval. Der Warzenfortsatz ist klein. Der Gesichtsschädel erscheint im Vergleich zum
einem breitgerundeten Oval. Der Warzenfortsatz ist klein. Der Gesichtsschädel erscheint im Vergleich zum
einem breitgerundeten Oval. Der Warzenfortsatz ist klein. Der Gesichtsschädel erscheint im Vergleich zum
rezenten Menschen sehr groß, was unter anderem auf die erhebliche Jochbogenbreite (153 mm) zurückzu-
rezenten Menschen sehr groß, was unter anderem auf die erhebliche Jochbogenbreite (153 mm) zurückzu-
rezenten Menschen sehr groß, was unter anderem auf die erhebliche Jochbogenbreite (153 mm) zurückzu-
rezenten Menschen sehr groß, was unter anderem auf die erhebliche Jochbogenbreite (153 mm) zurückzu-
führen ist. Die breiten und hohen Augenhöhlen sind am oberen Rand mehr gerundet, und die Nasenhöhle
führen ist. Die breiten und hohen Augenhöhlen sind am oberen Rand mehr gerundet, und die Nasenhöhle
ist hoch und breit. Die Nasenbeine sind nach vorn gerichtet. Eine Wangengrube im Oberkiefer, die für den
rezenten Menschen typisch ist und bereits bei Steinheim vorliegt, fehlt bei allen klassischen Neandertalern.
Beim kräftig entwickelten langen Unterkiefer mit dem fliehenden Kinn stehen die Gelenkfortsätze, ähnlich
wie beim Homo Erectus, weit auseinander. Die Zähne sind meist größer als beim rezenten Menschen.
Das Alter des Schädels von La Chapelle wird mit 35.000 bis 45.000 Jahren angegeben und ist noch nicht
genauer bestimmt worden. Insgesamt werden die meisten Funde der europäischen Neandertaler zwischen
60.000 und 35.000 datiert (Oakley).
Die Frage nach dem verwandtschaftlichen Verhältnis zwischen dem Neandertaler und dem anatomisch
modernen Menschen wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Während die Vertreter eines strengen
„Replacement-Modells“ einen eigenen Artstatus (Homo neanderthalensis) postulieren, sehen die Vertreter
der multiregionalen Entwicklung des Homo sapiens eine Vermischung und somit nach dem biologischen
Artmodell eine Stellung des Neandertalers als Unterart (Homo sapiens neanderthalensis) als gesichert an.
Zwar scheinen jüngste genetische Befunde für die Befürworter des „Replacements“ und somit für einen eige-
nen Artstatus zu sprechen, andererseits sind jedoch erhebliche Zweifel an der Interpretation der Befunde
geäußert worden. Eine Lösung des „Neandertaler-Problems“ scheint noch nicht in greifbarer Nähe zu sein.
In der vorliegenden Rekonstruktion wurden die beim Originalfund nicht vorhandenen fossilen
Knochenteile braun dargestellt. Die in grauer Farbe dargestellten Teile deuten die Stellen an, die am
Original ergänzt wurden bzw. als Haftmasse zum Zusammenfügen der einzelnen Teile dienten.
Verfasser: Dr. sc. Arthur Windelband, Humboldt-Universität zu Berlin
2004 überarbeitet durch Herrn Stefan Flohr, Mitarbeiter der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
am Main